Verfassungsrecht: Die Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz
Es kommt nicht von ungefähr, dass wir manchmal Menschen dahingehend beurteilen, ob sie in guter oder schlechter Verfassung sind. Denn die Verfassung bestimmt, nach welchen Regeln alle Organe des Körpers zusammenspielen müssen, damit es der Gesamtheit gut geht. Das ist bei jedem einzelnen Menschen so, aber auch beim Staat, den sich die früheren Staatsrechtstheoretiker ja auch als Körper vorgestellt haben (weswegen wir auch heute noch im Verwaltungsrecht mit Begriffen wie „Körperschaft“, „juristische Person“ und „Organ“ arbeiten).
Die Verfassung der Bundesrepublik heißt bekanntlich Grundgesetz. Aber nicht jeder weiß, dass nicht nur die Bundesrepublik ein Staat mit einer eigenen Verfassung ist, sondern auch die einzelnen Bundesländer eigene Staatsqualität haben. Die Folge ist, dass alle Bundesländer auch jeweils eigene Verfassungen haben.
Die rechtliche Auseinandersetzung mit diesen Verfassungen und den darin enthaltenen Regeln, nach denen die Organe des Staates zu handeln haben, ist Gegenstand des Verfassungsrechts. Von zentraler Bedeutung sind insoweit zunächst die Vorschriften über die staatliche Willensbildung, also die Grundanforderungen an die Wahlen der Parlamente, die Bildung der Regierungen sowie Einrichtung der Behörden, die Gesetzgebung und Gewährleistung einer unabhängigen und effizienten Rechtsprechung. Unsere Verfassungen kennen darüber hinaus aber mit den sogenannten Grundrechten auch Vorschriften, die den Mitgliedern des Staates, den Bürgern, eigene Rechte gegenüber dem Staat verleihen, und zwar eine Fülle verschiedener Abwehrrechte, aber auch Teilhaberechte.
Wie Sie Ihre Grundrechte vor den Gerichten durchsetzen können
Die Grundrechte sind die wichtigsten Rechte, die Ihnen als Bürgerin bzw. Bürger in Deutschland zustehen. Sie schützen Sie vor Eingriffen des Staates in Ihre Freiheit, Würde und Gleichheit. Sie sind in den Artikeln 1 bis 19 des Grundgesetzes festgeschrieben und haben einen besonderen Rang, da sie nur mit einer Zweidrittelmehrheit des Bundestages und des Bundesrates geändert werden können. Die Grundrechte sind also die grundlegenden Werte und Prinzipien, die das Zusammenleben in einer demokratischen und rechtsstaatlichen Gesellschaft ermöglichen.
Die Grundrechte binden alle staatlichen Organe
Die Grundrechte gelten nicht nur für das Handeln der Regierung oder des Parlaments, sondern auch für alle anderen staatlichen Organe, wie zum Beispiel die Polizei, das Ordnungsamt, das Finanzamt und so weiter. Das bedeutet, dass diese Organe bei ihrem Umgang mit Ihnen die Grundrechte respektieren müssen. Wenn sie das nicht tun, verletzen sie Ihre Grundrechte. Die Grundrechte sind also Abwehrrechte gegenüber dem Staat, die Ihnen eine gewisse Autonomie und Freiheitssphäre garantieren. Sie können sich auf Ihre Grundrechte berufen, wenn Sie der Meinung sind, dass eine staatliche Maßnahme oder Entscheidung Ihre Rechte verletzt oder einschränkt. Zum Beispiel können Sie sich auf das Grundrecht der Meinungsfreiheit berufen, wenn Sie wegen Ihrer politischen Äußerungen verfolgt werden, oder auf das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung, wenn Sie eine unrechtmäßige Durchsuchung erleiden. Die Grundrechte sind aber nicht absolut, sondern können unter bestimmten Voraussetzungen eingeschränkt werden, zum Beispiel wenn es um den Schutz anderer Rechtsgüter oder um die Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung geht. Die Einschränkungen müssen aber immer verhältnismäßig sein, das heißt, sie müssen geeignet, erforderlich und angemessen sein, um das verfolgte Ziel zu erreichen.
Die Verfassungsgerichte sind die Hüter der Grundrechte
Wenn Sie eine Grundrechtsverletzung feststellen, können Sie sich aber nicht direkt an die Verfassungsgerichte wenden. Die Verfassungsgerichte sind nämlich nicht dafür zuständig, Ihnen in jedem Einzelfall zu Ihrem Recht zu verhelfen oder für Gerechtigkeit zu sorgen. Sie sind auch nicht Teil des normalen gerichtlichen Instanzenzugs. Die Verfassungsgerichte haben vielmehr die Aufgabe, die Einhaltung der Verfassung als Ganzes zu überwachen und zu gewährleisten. Deshalb können Sie die Verfassungsgerichte nur in Ausnahmefällen anrufen, zum Beispiel wenn die einfachen Gerichte ein Grundrecht übersehen oder willkürlich entschieden haben. In Deutschland gibt es zwei Verfassungsgerichte: das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, das für die Auslegung des Grundgesetzes zuständig ist, und die Landesverfassungsgerichte, die die Landesverfassungen interpretieren. Die Verfassungsgerichte können zum einen von den anderen staatlichen Organen angerufen werden, wenn es um die Klärung von verfassungsrechtlichen Fragen geht, zum Beispiel bei einem Gesetzeskonflikt zwischen dem Bund und den Ländern oder bei einem Streit zwischen den Verfassungsorganen. Zum anderen können die Verfassungsgerichte von Bürgerinnen und Bürgern angerufen werden, wenn sie sich durch eine staatliche Maßnahme oder Entscheidung in Ihren Grundrechten verletzt fühlen. Dies ist die sogenannte Verfassungsbeschwerde.
Die Verfassungsbeschwerde ist das letzte Mittel zur Verteidigung Ihrer Grundrechte
Wenn Sie alle anderen Rechtsmittel ausgeschöpft haben und immer noch der Ansicht sind, dass Ihre Grundrechte verletzt wurden, können Sie als letzte Möglichkeit eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht oder beim zuständigen Landesverfassungsgericht einlegen. Die Verfassungsbeschwerde ist ein besonderes Rechtsmittel, das Ihnen die Möglichkeit gibt, sich direkt an die obersten Hüterinnen und Hüter der Verfassung zu wenden. Sie müssen aber beachten, dass Sie die Verfassungsbeschwerde nur innerhalb einer bestimmten Frist einlegen können, die je nach Fall unterschiedlich ist. In der Regel beträgt die Frist ein Jahr ab dem Zeitpunkt, an dem die angegriffene Maßnahme oder Entscheidung Ihnen bekannt wurde. Außerdem müssen Sie genau begründen, welches Grundrecht durch welche staatliche Maßnahme oder Entscheidung verletzt wurde. Die Verfassungsbeschwerde ist also kein einfaches oder schnelles Verfahren, sondern erfordert viel Sorgfalt und Vorbereitung. Die Verfassungsgerichte prüfen nicht jede Verfassungsbeschwerde, sondern nur diejenigen, die sie für besonders wichtig oder begründet halten. Wenn eine Verfassungsbeschwerde angenommen wird, kann das Verfassungsgericht verschiedene Entscheidungen treffen, zum Beispiel die angegriffene Maßnahme oder Entscheidung für nichtig erklären, eine Verletzung eines Grundrechtes feststellen oder eine Wiederholung des Verfahrens vor den einfachen Gerichten anordnen. Die Entscheidungen der Verfassungsgerichte sind für alle staatlichen Organe verbindlich und müssen von ihnen umgesetzt werden.
Die Verfassungsbeschwerde ist ein häufig genutztes
Rechtsmittel in der Bundesrepublik Deutschland. Jährlich werden mehrere Tausend
Verfassungsbeschwerden beim Bundesverfassungsgericht und den
Landesverfassungsgerichten erhoben. Die meisten davon richten sich gegen die
Verletzung von Grundrechten aus dem ersten Abschnitt des Grundgesetzes, wie
etwa das Recht auf freie Meinungsäußerung, das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung oder das Recht auf ein faires Verfahren. Jedoch haben nur
wenige Verfassungsbeschwerden Erfolg; die Erfolgsquote liegt bei ungefähr 2,7 Prozent. Die geringe Erfolgsquote beruht zum einen darauf, dass
viele Verfassungsbeschwerden den formalen Anforderungen nicht genügen oder
keine ausreichende Begründung enthalten. Zum anderen beruht sie darauf, dass
die Verfassungsgerichte nicht die Tatsachenfeststellungen der einfachen
Gerichte überprüfen, sondern lediglich die Auslegung und Anwendung der
Grundrechte. Daher müssen die Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer nicht nur eine Verletzung
ihrer Grundrechte, sondern auch eine willkürliche oder verfassungswidrige
Rechtsanwendung nachweisen. Dies ist oft schwierig und erfordert eine
eingehende Kenntnis der Rechtsprechung der Verfassungsgerichte. Die
Verfassungsbeschwerde ist somit kein Allheilmittel, sondern ein
außergewöhnliches Rechtsmittel, das nur in gravierenden Fällen in Betracht
gezogen werden sollte.
Zur freundlichen Beachtung:
Im Verfassungsrecht werden wir grundsätzlich nur für Unternehmen, Hochschulen, Vereine/Verbände, Bildungsinstitutionen, Parteien und Abgeordnete tätig und nicht für Privatpersonen. Ausnahmsweise werden wir in Einzelfällen auch für Privatpersonen tätig, sofern die Rechtssache einen eindeutigen bildungsrechtlichen Bezug aufweist.
Verfassungsrecht: Politische Parteien
Politische Parteien sind von besonderer Bedeutung. Sie wirken insbesondere in staatlichen Gremien bei der Willensbildung mit und versuchen, in staatlichen Verbänden Ämter und Posten mit ihren Mitgliedern zu besetzen, um so ihre Ziele zu verfolgen und durchzusetzen. Weil sie insoweit eine zentrale Aufgabe in den Räten der Gemeinden und Kreise, in Landtagen und im Bundestag wahrnehmen, sind sie bereits im Grundgesetz in Art. 21 und in vielen Landesverfassungen ausdrücklich erwähnt und mit der Aufgabe betraut, an der Erfüllung staatliche Aufgaben mitzuwirken. Darüber hinaus gilt für sie das Parteiengesetz, das eine Fülle von besonderen Rechten und Pflichten enthält. Politische Parteien dürfen zum Beispiel an Wahlen teilnehmen, müssen aber selber auch demokratisch verfasst sein. Im Idealfall sorgen sie dadurch für eine kontinuierliche und lebendige Verbindung zwischen dem Staatsvolk und den staatlichen Organen.
Bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben kann es zu einer Fülle von rechtlichen Fragen kommen. So können bereits im Wahlkampf Äußerungen des politischen Gegners bei Wahlkampfveranstaltungen oder in der Wahlwerbung rechtswidrig sein oder es kann die Frage auftreten, ob eine Partei möglicherweise zu Unrecht nicht von der Wahlleitung zur Wahl zugelassen wurde. In den gewählten Gremien stellt sich häufig die Frage, auf welche Weise die zu bildenden Ausschüsse besetzt werden, um eine möglichst spiegelbildliche Zusammensetzung zu gewährleisten. Frage- und Antragsrechte müssen mitunter mit gerichtlicher Hilfe durchgesetzt werden. Aber auch außerhalb dieser Gremien kann eine Vielzahl von Streitigkeiten gerichtlich zu klären sein, etwa dann, wenn staatliche Medien politische Partien nicht gleichbehandeln, Parteien Mitglieder ausschließen wollen oder gar eine Partei verboten werden soll.
Verfassungsrechtliche Vorgaben für politische Parteien
Politische Parteien sind durch das Parteiengesetz und das Grundgesetz geregelt. Sie haben das Recht, sich zu bilden und frei zu betätigen, unterliegen jedoch bestimmten Anforderungen und Pflichten.
Parteiengesetz
Das Parteiengesetz definiert die rechtlichen Rahmenbedingungen für politische Parteien, einschließlich:
- Die Anforderungen an die demokratische Binnenstruktur
- Die Transparenz in der Finanzierung
- Die Rechenschaftspflicht gegenüber dem Bundeswahlleiter
Es stellt sicher, dass Parteien demokratisch organisiert sind und sich transparent finanzieren, um faire politische Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten.
Verfassungsmäßige Rechte der politischen Parteien
Politische Parteien haben eine Reihe von verfassungsmäßigen Rechten, die ihre Rolle im politischen System stärken:
- Artikel 21 des Grundgesetzes gewährt Parteien das Recht, sich frei zu bilden und an der politischen Willensbildung des Volkes mitzuwirken.
- Parteien haben das Recht auf Chancengleichheit bei Wahlen. Dies beinhaltet die Teilnahme an Wahlen und den Zugang zu staatlichen Mitteln für den Wahlkampf.
- Parteien können sich auf die Meinungs- und Versammlungsfreiheit berufen, um politische Veranstaltungen abzuhalten und ihre Positionen öffentlich zu vertreten.
- Parteien dürfen ihre inneren Angelegenheiten autonom regeln, solange sie den demokratischen Grundsätzen folgen.
Berufung auf das Grundgesetz
Politische Parteien können sich in verschiedenen Konstellationen auf das Grundgesetz berufen:
- Im Falle von Konflikten mit staatlichen Institutionen oder anderen Parteien können sie ihre verfassungsmäßigen Rechte vor Gericht verteidigen.
- Parteien können das Bundesverfassungsgericht anrufen, um die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen und staatlichen Maßnahmen zu überprüfen, die ihre Rechte beeinträchtigen könnten.
- Bei der Organisation von Wahlkämpfen und politischen Veranstaltungen können Parteien ihre Grundrechte nutzen, um ungehindert ihre Botschaften zu verbreiten und Unterstützung zu mobilisieren.
- Parteien können sich auf das Grundgesetz berufen, um sich gegen Diskriminierung und ungerechtfertigte Einschränkungen ihrer politischen Aktivitäten zu wehren.
Praktische Beispiele
Es gibt zahlreiche praktische Beispiele, wann sich Parteien auf das Grundgesetz berufen können und wann dies juristisch relevant wird:
- Eine Partei fühlt sich bei der Vergabe von Wahlkampfmitteln durch den Staat benachteiligt und beruft sich auf das Recht auf Chancengleichheit gemäß Artikel 21 des Grundgesetzes.
- Eine Partei möchte eine politische Veranstaltung abhalten, wird jedoch von den lokalen Behörden daran gehindert. Sie beruft sich auf die Versammlungsfreiheit gemäß Artikel 8 des Grundgesetzes und klagt vor dem Verwaltungsgericht.
- Eine Partei wird von staatlichen Stellen diskriminiert und ihre politischen Aktivitäten werden eingeschränkt. Sie beruft sich auf das Diskriminierungsverbot und das Recht auf politische Betätigung gemäß Artikel 3 und Artikel 21 des Grundgesetzes.
- Eine Partei sieht ihre Meinungsfreiheit verletzt, wenn ihr die Nutzung öffentlicher Räume für Kundgebungen verboten wird. Sie beruft sich auf Artikel 5 des Grundgesetzes und klagt vor dem Bundesverfassungsgericht.
- Eine Partei sieht ihre Rechte durch ein neues Gesetz verletzt, das ihre Finanzierung einschränkt. Sie ruft das Bundesverfassungsgericht an, um die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes zu überprüfen.
Schlussfolgerung
Derartige Verfahren sind nicht immer vor den Verfassungsgerichten zu führen. Häufig sind die Verwaltungsgerichte oder die ordentlichen Gerichte hierfür zuständig. Das gilt insbesondere dann, wenn es um die Rechte und Pflichten der Parteien und ihrer Mitglieder in den Kommunalvertretungen, also in den Gemeinde- und Stadträten sowie in den Kreistagen geht. Häufig ist insoweit erforderlich, schnell die rechtliche Klärung herbeizuführen und daher diese Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz zu führen.
Wir verfügen über mehrjährige Erfahrung bei der Vertretung von Parteien sowohl hinsichtlich der Verfahren vor den Instanzgerichten als auch in verfassungsgerichtlichen Verfahren.
Aktuelle Neuigkeiten
Filtern
 GewerberechtVerfassungsrechtVerwaltungsrecht03.07.2022
GewerberechtVerfassungsrechtVerwaltungsrecht03.07.2022Teipel & Partner berät Verband von dreitausend bayerischern Firmen zu Coronamaßnahmen
Teipel & Partner berät einen bayerischen Verband, dem rund dreitausend Firmen unterschiedlicher Größe angeschlossen sind, zu Corona-Schutzmaßnahmen.![Erfolg in eigener Sache gegen Landesgesundheitsministerium NRW vor VG Düsseldorf [Corona]](data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20width%3D%223421%22%20height%3D%222280%22%20style%3D%22background-color%3Atransparent%22%3E%3C%2Fsvg%3E) VerfassungsrechtVerwaltungsrecht24.03.2022
VerfassungsrechtVerwaltungsrecht24.03.2022Erfolg in eigener Sache gegen Landesgesundheitsministerium NRW vor VG Düsseldorf [Corona]
MAGS NRW räumt ein: Verwaltungserlass erfolgte nicht auf Grundlage der jeweils vorliegenden infektiologischen Erkenntnisse, der jeweils aktuellen Empfehlung der STIKO beim RKI oder der epidemiologischen Situation vor Ort. GewerberechtVerfassungsrechtVerwaltungsrecht30.08.2021
GewerberechtVerfassungsrechtVerwaltungsrecht30.08.2021Coronabedingte Schließung einer Freizeitsportanlage verhindert.
Teipel & Partner wurden durch Hamburger Holding beauftragt, eine Schließung eines Unternehmens für Freizeitsport zu verhindern. GewerberechtVerfassungsrechtVerwaltungsrecht16.12.2020
GewerberechtVerfassungsrechtVerwaltungsrecht16.12.2020Teipel & Partner vertritt großes Unternehmen der Lebensmittelindustrie aus NRW
Teipel & Partner hat im Rahmen der Corona-Pandemie ein großes lebensmittelverarbeitendes Unternehmen aus NRW mit Saisonarbeitern gegenüber den örtliche Gesundheitsbehörden vertreten.



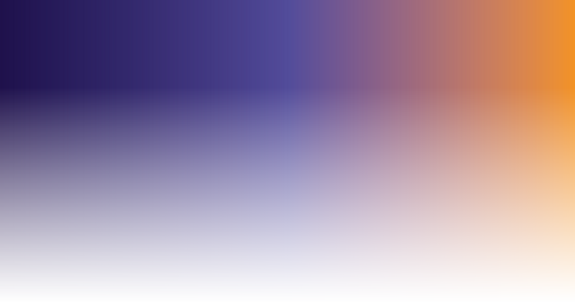

![Erfolg in eigener Sache gegen Landesgesundheitsministerium NRW vor VG Düsseldorf [Corona]](/media/img/weblication/wThumbnails/Taeuschung-Plagiat-Teipel-Partner-Rechtsanwaelte-78c7b80d-a52f432f@ll.jpg)