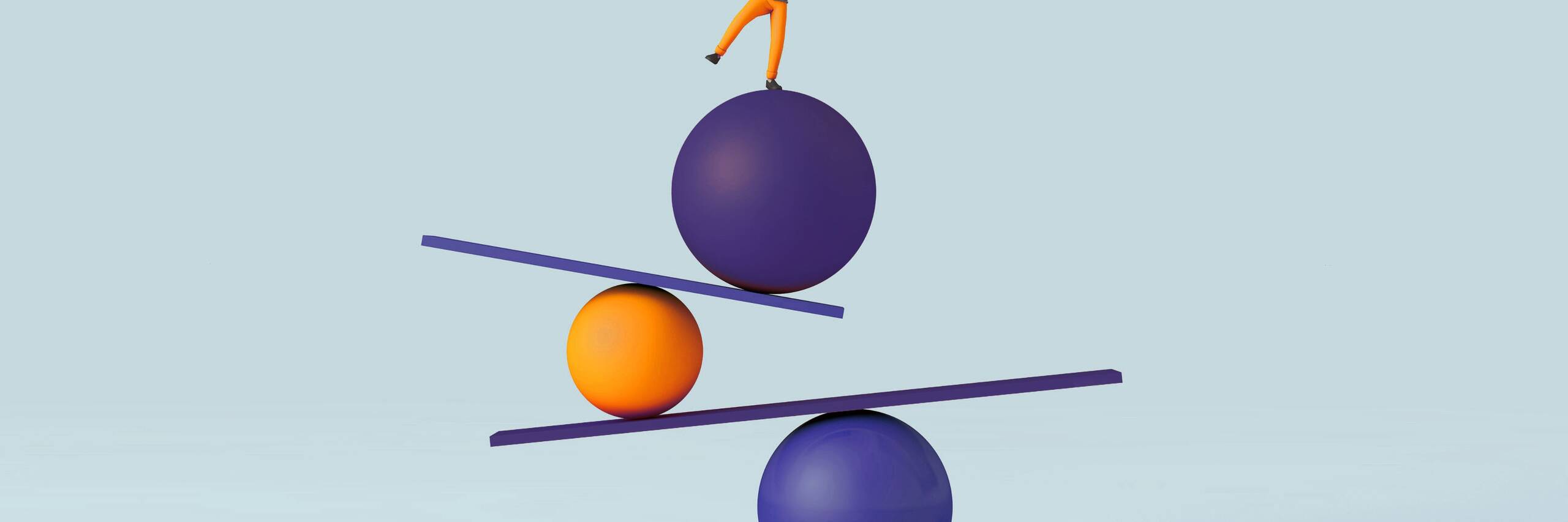teipel.law verteidigt erfolgreich private Hochschule gegen Prüfungsanfechtung
Eine Studentin unserer Mandantin hatte im Letztversuch die Modulprüfung in ihrem Bachelorstudiengang nicht bestanden. Nach der Prüfungsordnung hatte dies den Verlust des Prüfungsanspruchs und damit die Beendigung des Studiengangs und auch des Studienrechtsverhältnisses zur Folge. Dies stellte unsere Mandantin durch Bescheid fest.
Dagegen hat die Studierende geklagt und vorgetragen, sie sei am Tage der letzten Prüfung krank gewesen, weshalb sie nicht in der Lage gewesen sei, die Prüfungsleistung zu erbringen.
Grundsätzlich gilt aus Gründen der Prüfungsgerechtigkeit und insbesondere der Chancengleichheit, dass, wer an einer vorübergehenden Erkrankung leidet und daher nicht wie Gesunde eine Prüfungsleistung erbringen kann, dies auch nicht muss. Entscheidend ist in diesen Fällen, dass unverzüglich - im Idealfall noch vor Prüfungsbeginn - der Rücktritt von der Prüfung erklärt und ein ärztliches Attest (Achtung: Eine Krankschreibung für Arbeitgeber genügt nicht!) eingereicht wird, aus dem sich zwar nicht zwingend eine Diagnose ergeben muss, wohl aber der Grund für die Prüfungsunfähigkeit (z.B. hohes Fieber und daraus folgende Konzentrationsschwierigkeit, Müdigkeit und so fort). Aufgrund dieser Tatsachenbasis hat dann die Prüfungsbehörde über den Rücktritt von der Prüfung zu entscheiden und nach unserer Erfahrung ergeben sich insoweit nicht einmal dann Probleme, wenn derartige Anträge zwar erst nach der Prüfung, aber in enger zeitlicher Nähe dazu und insbesondere noch vor Mitteilung des Prüfungsergebnisses gestellt werden.
Anders sieht es aus, wenn der Rücktritt erst nach der Mitteilung des Prüfungsergebnisses erklärt wird. Dann ist ein Rücktritt regelmäßig nicht möglich, weil Studierende sich so anderenfalls einen gegenüber den anderen Studierenden prüfungsungerechten und chancengleichheitswidrigen Vorteil verschaffen könnten. Denn sie würden abwarten können, ob die Prüfung erfolgreich war und wenn nicht - gestützt auf ihre damalige Prüfungsunfähigkeit - einen weiteren, zusätzlichen Versuch unternehmen dürfen.
Zwar wird diskutiert, dass jedenfalls dann, wenn Studierende im Zeitpunkt der Prüfung nicht wussten oder nicht erkannt hatten, dass sie krank sind, davon eine (Rück-)Ausnahme zu machen sei. Aber das setzt nicht nur voraus, dass ein nachträgliches Attest sowohl die Prüfungsunfähigkeit am Prüfungstag als auch die Tatsachen und Methoden aufführt, aufgrund derer nachträglich diese Feststellung getroffen werden konnte; vielmehr ist außerdem nachzuweisen, warum die Krankheit nicht früher, insbesondere am Prüfungstage selbst erkannt werden konnte (hier gilt eine sogenannte Parallelwertung in der Laiensphäre) und zusätzlich, warum zu keinem früheren Zeitpunkt die Erklärung des Rücktritts möglich war.
Wiederum anderes gilt, wenn die Krankheit nicht vorübergehend, sondern langandauernd und somit chronisch ist, also insbesondere bei Dauerleiden und Behinderungen. In solchen Fällen ist ein Prüfungsrücktritt nicht möglich. Allerdings haben Studierende dann die Möglichkeit, Nachteilsausgleiche zu beantragen, sofern diese Krankheiten nicht die durch die Prüfungsleistung nachzuweisenden Fähigkeiten und Fertigkeiten selbst betreffen, sondern deren Nachweis (z.B. Studierende mit AD(H)S können eine reizarme Umgebung für die Prüfung erhalten, Studierende mit einem „Tennisarm“ eine Schreibzeitverlängerung und so fort).
Das, und nicht eine unverschuldet unerkannte, vorübergehende krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit, kam vorliegend in Betracht. Denn die Klägerin wurde wenige Wochen nach der Prüfung mit lebensbedrohlichen Symptomen in einer Klinik aufgenommen. Grund dafür war ein psychisch bedingtes, anhaltendes und extremes Untergewicht (Anorexia nervosa). Das ist eine Konstellation, hinsichtlich derer das Bundesverwaltungsgericht erst vor wenigen Jahren entschieden hat, dass eher nicht der nachträgliche Rücktritt von der Prüfung, wohl aber ein nachträglicher Antrag auf Bewilligung eines Nachteilsausgleichs in Betracht kommen könnte einhergehend mit der Aufhebung der Bewertung der im Falle des erfolgreichen Antrags dann ja rechtswidrig (weil ohne Nachteilsausgleich) erbrachten Prüfungsleistung. Allerdings greifen auch hier die Überlegungen für einen solchen nachträglichen Nachteilsausgleichsantrag, wie sie für den nachträglichen Rücktritt von der Prüfung gelten: Es sind Atteste erforderlich, aus denen sich insbesondere ergibt, dass und warum der Nachteilsausgleich nicht schon vor oder unmittelbar nach der Prüfung hätte beantragt werden können.
Ob diese Variante hier überhaupt gegriffen hätte, war zudem deshalb fraglich, weil es eine ganze Fülle von Behinderungen gibt, bei denen gleichzeitig sowohl Nachteilsausgleiche als auch einzelne Rücktritte von der Prüfung wegen vorübergehender Prüfungsunfähigkeit in Betracht kommen. Vielfach Gegenstand von Gerichtsentscheidungen ist beispielsweise die Migräne. Zur Vermeidung von Migräneattacken sind Nachteilsausgleiche wie zum Beispiel keine Verwendung von Neonlicht während der Prüfungen oder im Studienbetrieb möglich und bei akuten Attacken kommt der Rücktritt von der jeweiligen Prüfung oder ihr Abbruch in Betracht.
Aber, und so haben wir es vorgetragen, in allen diesen Konstellationen kommt es, wenn der Rücktritt nachträglich und insbesondere erst nach Bekanntwerden des Notenergebnisses erfolgt, auf die unverschuldet unerkannte Prüfungsunfähigkeit am Tage der Prüfung und ihren Nachweis durch Atteste an, wobei die Atteste die oben genannten Kriterien erfüllen müssen.
Solche Atteste gab es im Falle der Klägerin nicht und wir hätten sie, wenn es sie gegeben hätte, wohl auch angegriffen. Denn die Klägerin hatte in nahem zeitlichen Zusammenhang andere Prüfungen abgelegt und bestanden.
Vor diesem Hintergrund hat die Klägerin eine vernünftige Entscheidung getroffen und die Klage zurückgenommen.
Von Teipel & Partner mandatsführend:
Weitere Informationen zu Dr. Jürgen Küttner
- Spezialist im Prüfungsrecht und Beamtenrecht
- Fachanwalt für Verwaltungsrecht seit 2008.
- Promotion zum Dr. „in utroque iure“ (kanonischem und weltlichem Recht)
- Über 500 persönlich geführte Verfahren im Prüfungsrecht/Hochschulrecht
- Erfolge vor dem Bundesverwaltungsgericht (sowohl Revisionsnichtzulassungsbeschwerde als auch Revision) wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache und dem Bundesfinanzhof.
Dr. Jürgen Küttner steht Ihnen insbesondere im Prüfungsrecht und im Beamtenrecht als hochqualifizierter Ansprechpartner zur Verfügung.
Dr. Jürgen Küttner war mandatsführend in folgenden Verfahren
 14.11.2025Beamtenrecht
14.11.2025BeamtenrechtErfolgreiches Widerspruchsverfahren gegen Ausschluss aus dem Auswahlverfahren für die Einstellung in den Polizeidienst
teipel.law erzielen raschen Erfolg gegen Einstufung als polizeidienstuntauglich. 13.11.2025Prüfungsrecht
13.11.2025PrüfungsrechtErfolgreiche Prüfungsanfechtung Erste Staatsprüfung für das Lehramt Bayern
Erfolg im Prüfungsrecht: teipel.law erreichen Neubewertung der Prüfungsleistung. 08.08.2025PrivathochschulrechtVerfahren
08.08.2025PrivathochschulrechtVerfahrenteipel.law verteidigt erfolgreich private Hochschule im einstweiligen Rechtschutz
Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen Bewertung einer mündlichen Abschlussprüfung blieb erfolglos 25.07.2025Verfahren
25.07.2025VerfahrenErfolgreiche Verteidigung privater Hochschule gegen Prüfungsanfechtung
teipel.law verteidigt erfolgreich eine staatlich anerkannte, private Hochschule gegen die Anfechtung der Feststellung des Nichtbestehens wegen Täuschung 20.05.2025Verfassungsrecht
20.05.2025VerfassungsrechtVolt NRW mit teipel.law erfolgreich vor dem Verfassungsgerichtshof NRW: Kommunalwahlgesetz NRW ist verfassungswidrig!
Volt NRW war die erste Partei im Organstreitverfahren gegen das neue Kommunalwahlgesetz NRW. Nun führte das durch teipel.law betriebene Organstreitverfahren zur Feststellung der Verfassungswidrigkeit der vom Landtag NRW beschlossenen Neuregelung der Sitzverteilung bei Kommunalwahlen (Rock-Verfahren). 19.05.2025PrivathochschulrechtVerfahren
19.05.2025PrivathochschulrechtVerfahrenErfolgreiche Verteidigung privater Hochschule durch teipel.law
Selbstplagiate (oder auch Eigenplagiate genannt) sind in Prüfungen gefährlich; Prüfungsanfechtung blieb erfolglos
Nehmen Sie hier Ihre Buchung für eine Erstberatung bequem online vor
Weitere Erfolgreiche Verfahren:
 PrivathochschulrechtVerfahrenPrüfungsrecht10.11.2023
PrivathochschulrechtVerfahrenPrüfungsrecht10.11.2023teipel.law erfolgreich bei Verteidigung einer privaten Hochschule gegen Prüfungsanfechtung
Fehlender unverzüglicher Rücktritt von einer Prüfung wegen Krankheit und fehlender Antrag auf Nachteilsausgleich wegen chronischer Erkrankung oder Behinderung (rezidivierende depressive Störung). PrivathochschulrechtVerfahrenPrüfungsrecht18.10.2023
PrivathochschulrechtVerfahrenPrüfungsrecht18.10.2023Erfolgreiche Abwehr einer Klage gegen eine private Hochschule aus Hessen im Püfungsrecht.
teipel gewinnt für eine private Hochschule aus Hessen ein gegen diese gerichtetes Klageverfahren in Bezug auf eine Täuschungshandlung. PrivathochschulrechtVerfahrenPrüfungsrecht24.05.2023
PrivathochschulrechtVerfahrenPrüfungsrecht24.05.2023Erfolgreiche Verteidigung einer privaten Hochschule gegen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung im Prüfungsrecht
teipel konnten erfolgreich einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gegen eine private Hochschule abwehren. PrivathochschulrechtVerfahrenPrüfungsrecht19.09.2022
PrivathochschulrechtVerfahrenPrüfungsrecht19.09.2022Erfolgreiche Verteidigung einer privaten Hochschule gegen Klage wegen Nichtbestehens der Masterprüfung aufgrund von Täuschung
Teipel & Partner konnten erfolgreich eine Klage gegen eine private Hochschule gegen die Bewertung einer Masterprüfung mit „nicht bestanden“ abwehren.